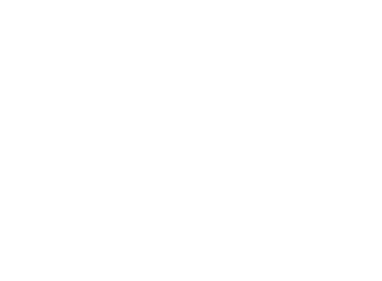Voodoo Beach
Der Mond steht von starren Wolkenschlieren verbrämt über dem nächtlichen Meer. Es stellt sich die Frage: bleiben sie dort, die zarten Wolken, auch wenn der alte Kalktrabant weiterdreht, um das Wasser mitzuziehen? Sie haben sich eingerichtet, in ihrer Luftschicht, scheinen zu verharren, wie ein paar sture Vögel, die sich nicht einmal durch Gewehrsalven von der Oberleitung verscheuchen ließen. So oder so: da am Strand, mit den reglosen Wolken und unter der Gemächlichkeit der weißen Scheibe, ist alles still, liegt der Sand in Frieden, wird vom Salzwasser mehr massiert als dass die Brandung ihn in Aufruhr versetzte. Das Feuer, aus getrocknetem Treibholz geschichtet, glimmt vor sich hin, atmet in ruhigen Zügen die salzige Luft, scheint kurz vor dem Einschlafen. Ein lebendiges Stillleben.
Dann passiert etwas. Ein Sturm zieht auf, und die groben Holzstücke glimmen immer stärker, bis sich die Flammen auf den weitgereisten Oberflächen entzünden. Während die Wellen heftiger werden, der Sand aufwirbelt, die Flammen und Funken der Dunkelheit nun lodernd die Stirn bieten, kommen von der Straße drei Gestalten auf den Lichtkreis zugeschritten. Sie scheinen den Sturm mitzubringen, vor dem sogar die Krebse flüchten. Zwei Frauen und ein Mann, sie setzen sich auf den Boden, verteilen sich symmetrisch ums Feuer, in dem sich ihre Verbindungslinien kreuzen und dessen Flammen im Auge des Sturms ganz ruhig werden – als hörten sie auf die Gesetze einer außerirdischen Natur, während der nun wütende Wind bereits die angrenzenden Strandhütten verwüstet, Palmen abknickt, die Boote losmacht.
Dieser Sturm ist geschult an einem tiefen Noiserock der 1990er Jahre, mit Verzerrung und hartem Anschlag, dann jedoch in ruhigen, ekstatischen Zwischensequenzen, die mehr Traumreise sind. Doch spätestens die bildhaften Texte holen einen auf den harten Boden der Tatsachen zurück, machen die Musik zu einem wütenden, dann wieder sehnsüchtigen Fußmarsch. Voodoo Beach sind auf einer Reise durch die Nacht. Die eng miteinander verwobene Dreifaltigkeit Gitarre/Schlagzeug/Bass ragt dabei tief in den Raum, trägt eine dunkelblaue, fast schwarze Klangfarbe, die nicht nur von den präzisen Beckenblitzen und Snareschlägen erhellt wird, sondern auch von Heike Rädekers oft mehrstimmig gemischtem Gesang, der beobachtend durchs Fenster schaut, um es im nächsten Moment schon aus den Angeln zu heben. Und auch, wenn wir es hier ohne Frage mit einem treibenden Sound zu tun haben, gibt es durchaus Raum für mantrische Repetitionen einer ersehnten Ruhe, die aus all dem spricht. Keine Müdigkeit, nein: Ruhe. Voodoo Beach reihen sich damit ein in jenen losen Zusammenhang deutschsprachiger Rockbands der letzten zehn Jahre, finden gute Gesellschaft in den Nerven, Gewalt, Friends Of Gas, Culk und Co.! Der tief-reißende Bass kommt von John-H. Karsten, der auch die Texte schreibt, das Schlagzeug spielt Josephine Oleak, und an der Stromgitarre stehend singt bereits erwähnte Heike Rädeker einen Alltagsexistentialismus, der sich gewaschen hat.
Ihre rußverschmierten Gesichter zeigen sich im Licht der Flammen von Schrammen gezeichnet. Die Kleider tragen Risse. Doch sie sehen gut aus. Als die Freunde aufstehen, bricht der Sturm plötzlich ab. Die drei Reisenden klopfen den Sand von ihren Hosenböden und schreiten selbstsicher ins Meer, das jetzt wie ein Spiegel da liegt, in Regungslosigkeit. Die Wolken vorm Mond sind verschwunden, doch es bleibt Nacht. Das sind Voodoo Beach.
–Hendrik Otremba
Dann passiert etwas. Ein Sturm zieht auf, und die groben Holzstücke glimmen immer stärker, bis sich die Flammen auf den weitgereisten Oberflächen entzünden. Während die Wellen heftiger werden, der Sand aufwirbelt, die Flammen und Funken der Dunkelheit nun lodernd die Stirn bieten, kommen von der Straße drei Gestalten auf den Lichtkreis zugeschritten. Sie scheinen den Sturm mitzubringen, vor dem sogar die Krebse flüchten. Zwei Frauen und ein Mann, sie setzen sich auf den Boden, verteilen sich symmetrisch ums Feuer, in dem sich ihre Verbindungslinien kreuzen und dessen Flammen im Auge des Sturms ganz ruhig werden – als hörten sie auf die Gesetze einer außerirdischen Natur, während der nun wütende Wind bereits die angrenzenden Strandhütten verwüstet, Palmen abknickt, die Boote losmacht.
Dieser Sturm ist geschult an einem tiefen Noiserock der 1990er Jahre, mit Verzerrung und hartem Anschlag, dann jedoch in ruhigen, ekstatischen Zwischensequenzen, die mehr Traumreise sind. Doch spätestens die bildhaften Texte holen einen auf den harten Boden der Tatsachen zurück, machen die Musik zu einem wütenden, dann wieder sehnsüchtigen Fußmarsch. Voodoo Beach sind auf einer Reise durch die Nacht. Die eng miteinander verwobene Dreifaltigkeit Gitarre/Schlagzeug/Bass ragt dabei tief in den Raum, trägt eine dunkelblaue, fast schwarze Klangfarbe, die nicht nur von den präzisen Beckenblitzen und Snareschlägen erhellt wird, sondern auch von Heike Rädekers oft mehrstimmig gemischtem Gesang, der beobachtend durchs Fenster schaut, um es im nächsten Moment schon aus den Angeln zu heben. Und auch, wenn wir es hier ohne Frage mit einem treibenden Sound zu tun haben, gibt es durchaus Raum für mantrische Repetitionen einer ersehnten Ruhe, die aus all dem spricht. Keine Müdigkeit, nein: Ruhe. Voodoo Beach reihen sich damit ein in jenen losen Zusammenhang deutschsprachiger Rockbands der letzten zehn Jahre, finden gute Gesellschaft in den Nerven, Gewalt, Friends Of Gas, Culk und Co.! Der tief-reißende Bass kommt von John-H. Karsten, der auch die Texte schreibt, das Schlagzeug spielt Josephine Oleak, und an der Stromgitarre stehend singt bereits erwähnte Heike Rädeker einen Alltagsexistentialismus, der sich gewaschen hat.
Ihre rußverschmierten Gesichter zeigen sich im Licht der Flammen von Schrammen gezeichnet. Die Kleider tragen Risse. Doch sie sehen gut aus. Als die Freunde aufstehen, bricht der Sturm plötzlich ab. Die drei Reisenden klopfen den Sand von ihren Hosenböden und schreiten selbstsicher ins Meer, das jetzt wie ein Spiegel da liegt, in Regungslosigkeit. Die Wolken vorm Mond sind verschwunden, doch es bleibt Nacht. Das sind Voodoo Beach.
–Hendrik Otremba
Eintritt frei, aber Konzertbesuch nur mit „Romeo und Julia“-Premierenticket möglich.
mehr anzeigen