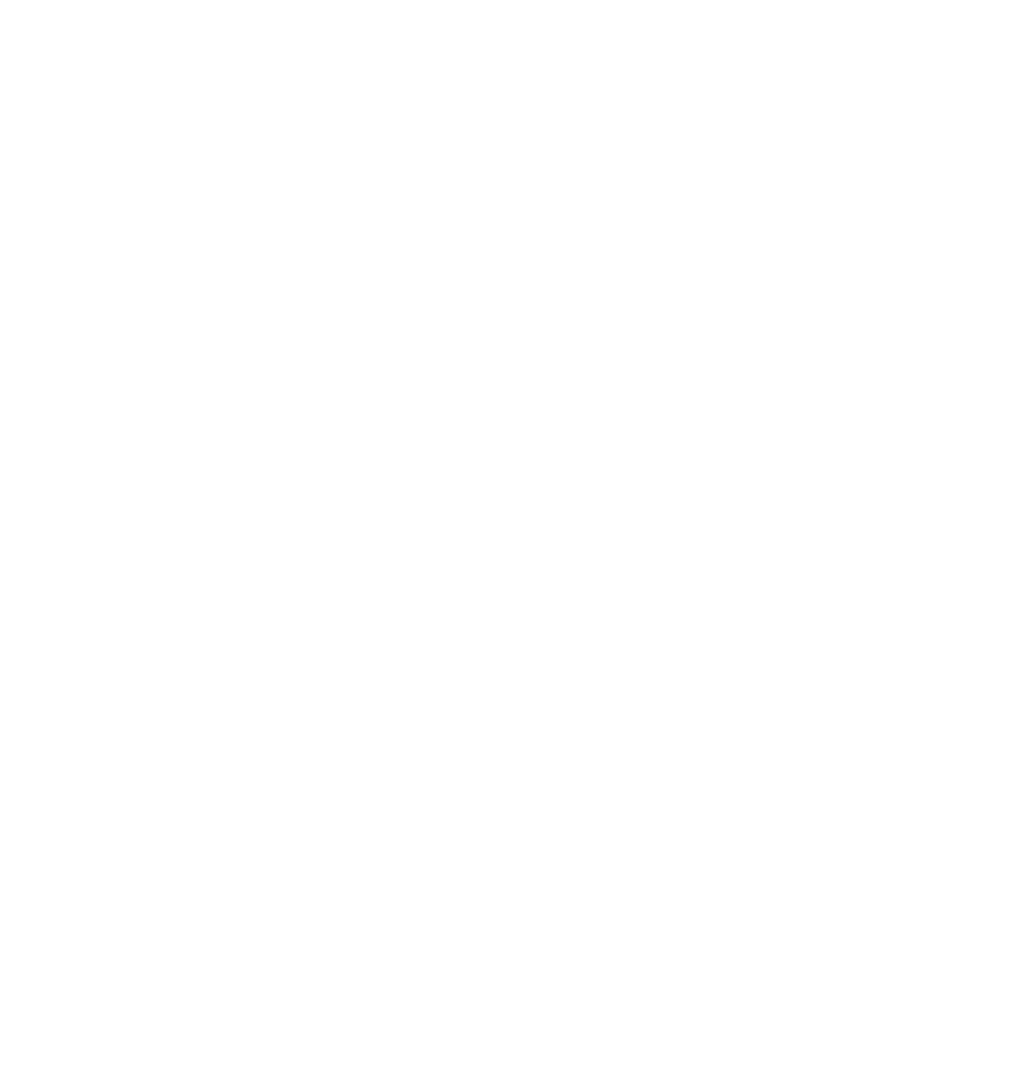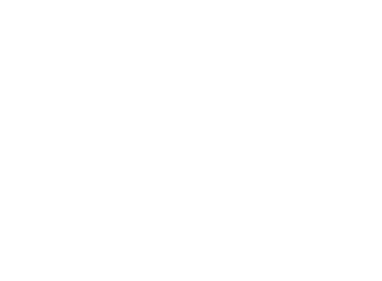Im Gespräch mit
Sandra Hüller
Sandra Hüller, du probst gerade am Schauspiel Leipzig zusammen mit der Gruppe FARN. collective das Projekt „The Shape of Trouble to Come“. Was ist für dich das Besondere an der Arbeit mit einer freien Gruppe?
SH: Ich bin ja Ensemble gewohnt, und FARN ist auch ein Ensemble, aber eben ein ganz kleines, wo jeder verschiedene Aufgaben hat, das finde ich daran so faszinierend. Es funktioniert relativ unhierarchisch. Wir versuchen die Aufgaben gerecht zu verteilen. Und dadurch gibt es natürlich aber auch eine andere Transparenz. Wir wissen, was mit dem Geld passiert, woher das kommt, wie wir das einsetzen. Das gibt einem eine große Verantwortung, auf der anderen Seite natürlich einen großen Einblick in diese Zusammenhänge. Und ich mag an dieser Gruppe die Art, wie wir uns gegenseitig Ideen geben. Es ist oft so, dass einer etwas sagt und dem Nächsten fällt dazu etwas ein und am Ende entsteht daraus eine ganze Geschichte, ein Bühnenteil, ein Kostümteil, ein Musikstück. Es ist wie eine Séance, wo alle Hände auf dem Dreieck sind und dann entsteht das immer mit allen – und das gefällt mir gut.
Mit welchen Geistern kommt ihr da so ins Gespräch?
SH: Das weiß ich gar nicht – aber es sind ganz viele Kräfte da anwesend, weil wir uns auch kaum reglementieren in den Erfindungen. Das kommt dann immer später, durch die Häuser logischerweise oder eben auch durch unsere eigene Unfähigkeit. Mal ganz ehrlich: Manche Dinge denkt man sich aus und merkt dann, ich kann das aber gar nicht. Und ich werde es auch in der kurzen Zeit nicht lernen.
Nehmt ihr dieses Scheitern, also das, was nicht geglückt ist, dann in irgendeiner Art und Weise in das Bühnenprodukt mit auf – oder sagt ihr dann: Okay, das war es jetzt nicht, wir machen etwas anderes?
SH: Das Scheitern ist ja in allem, was man auf der Bühne macht, mit drin, weil man ganz viele Wege gegangen ist, die nicht funktioniert haben – und dann den nimmt, der am meisten erzählt oder den man eben kann. Man geht mit der eigenen Begrenztheit um. Wenn man mit Ursula K. Le Guin spricht: Wir müssen mit diesen Heldenerzählungen einfach aufhören. Auch auf der Bühne, dass Schauspieler irgendwelche besonderen Wesen sind oder so was – nein, die können auch viele Sachen nicht.
Was ist Schauspielerei für dich – zwischen Handwerk und Kunst, wie würdest du das beschreiben?
SH: Das Handwerk hilft auf jeden Fall sehr, ich weiß nicht, was ich ohne meine Ausbildung machen würde. Ich glaube, da wäre ich relativ verloren – weil die ja bestimmte Parameter vorgibt, und Codes, in denen man sich bewegt. Und dann kann man die auch brechen. Ich weiß, wo die Grenze ist, um sie dann vielleicht zu überschreiten. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich vielleicht viel mehr mäandern. Und Kunst – ich habe immer gesagt, ich bin Arbeiterin, so sehe ich das immer noch. Aber es gibt Dinge im Prozess, die lassen sich nicht einfach mit Arbeit erklären. So etwas wie Inspiration oder wenn man das Gefühl hat an einem Abend, man ist so vollkommen getragen von etwas, was man jetzt gar nicht benennen kann, das geht, glaube ich, übers Handwerk hinaus.
Braucht man denn das Handwerk, um an diesen Punkt zu kommen?
SH: Das glaube ich nicht, nein, das macht jeder anders. Mir hilft das auf jeden Fall, diese Konkretheit immer zu haben. Das ist zum Beispiel bei uns eine andere Form, wenn man anders miteinander spielt und auch eher Wert auf die Gruppe legt als auf eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle, diese ganze Kategorisierung gibt es ja bei uns gar nicht. Wenn ich Lust habe, mit genau diesen Menschen anderthalb oder zwei Stunden auf der Bühne zu stehen, dann ist es noch mal etwas anderes, weil es tatsächlich eher mit einer Verbindung zueinander zu tun hat, die sich hoffentlich überträgt.
Worum geht es in „The Shape of Trouble to Come“ inhaltlich?
SH: Wir haben Gedanken, die uns sehr gefallen haben, von Donna Haraway, Ursula K. Le Guin, Paul Preciado und vielen anderen, aufgegriffen, bei denen es hauptsächlich darum geht, wie wir auf dieser Welt weitermachen können, ohne die Welt, in der wir leben, und damit uns und alles, was uns umgibt, zu zerstören. Das wäre tatsächlich Science Fiction im besten Sinne – und deswegen kann das total aufregend werden. Wie könnte das gehen, und zwar fernab von Elektroautos, erneuerbaren Energien und all diesem Schnack? Es geht eher um den tatsächlichen Einsatz des Menschen und um eine andere Art, diese Veränderung, die jetzt ansteht, überhaupt erst mal zu denken.
Du hast Science Fiction erwähnt – mit welchen SF-Gedanken arbeitet ihr?
SH: Der Kerngedanke geht von den Camille-Geschichten von Donna Haraway aus, aus dem Buch „Unruhig bleiben“, das für ziemlichen Wirbel gesorgt hat, auch bei mir. Das ist eine Erzählung, die versucht, Menschen mit Tieren oder aussterbenden Arten genetisch zu verbinden. Es geht um die Idee, dass es Siedlungen gegeben haben könnte (sie erzählt das alles aus der Zukunft, in unsere Vergangenheit quasi hinein), wo Menschen gesagt haben, es gibt einfach zu viele Menschen, wir bekommen erst mal keine eigenen Kinder, sondern wir strukturieren erst mal unsere Gesellschaft so, dass Kinder darin Platz haben. Und dann werden das nicht einfach unsere biologischen Kinder, sondern die werden verbunden mit einem Symbionten, mit einer aussterbenden Art, nehmen wir z. B. einen Monarchfalter. Ich will das jetzt natürlich nicht ganz erzählen. Und weil es eben keine Utopie ist, weil es sich immer aus der Vergangenheit speisen muss und auch aus dem Erbe der Vergangenheit, geht es am Ende sogar um Verbindungen mit den Toten. Das hört sich jetzt erst mal alles wahnsinnig gefährlich an, aber die Art und Weise, wie Frau Haraway und hoffentlich auch wir zu diesen Gedanken hinleiten, so dass sie einem am Ende wirklich logisch erscheinen, ist total interessant.
Es gibt ja so eine Art Gemeinplatz, Theater – oder Kunst allgemein – sei desto politischer, je provokanter oder kritischer es ist. Wie stehst du dazu?
SH: Ich halte gar nichts von Provokation in dem Sinne. Am Ende schafft das immer nur Aggression, und die Leute weigern sich, etwas zu sehen und anzuerkennen. Mir geht es eher um eine Einladung, gar nicht so sehr um eine Einladung zum Verstehen, da kann ich auch Tagesschau gucken, da ist das so gemacht, dass ich es kapiere. Sondern eine Einladung zum Erleben, zum Erfahren von einem Vorgang. Ich glaube, dass viele Leute nicht ins Theater gehen, weil sie Angst haben, etwas nicht zu verstehen – als sei das der Anspruch. Der ist es für mich als Zuschauerin aber auch nie, sondern ich verbringe Zeit mit vielen Menschen und schaue mir etwas an. Ich mache eine Erfahrung. Und vielleicht habe ich dann einen Gedanken, den ich vorher noch nicht hatte. Und der verängstigt mich vielleicht, das ist dann meine Entscheidung, aber ich komme in Räume rein, in denen ich sonst nicht bin. Das kann man mögen oder nicht, ich mags. Und ich mags vor allem noch mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehasst von der Bühne runter, weil ich zu doof bin oder weil ich nicht radikal genug bin. Wenn jemand auf der Bühne mir erzählt, er weiß es besser, da kann ich immer sagen: Das kannst du jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen. Aber wenn jemand mir und vor allem sich selbst Fragen stellt, das finde ich immer spannend. Und ich glaube, das versuchen wir.