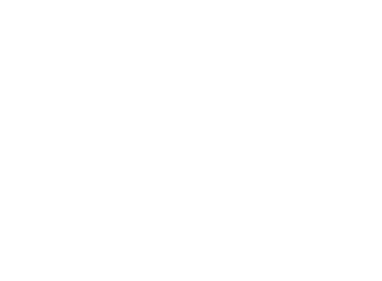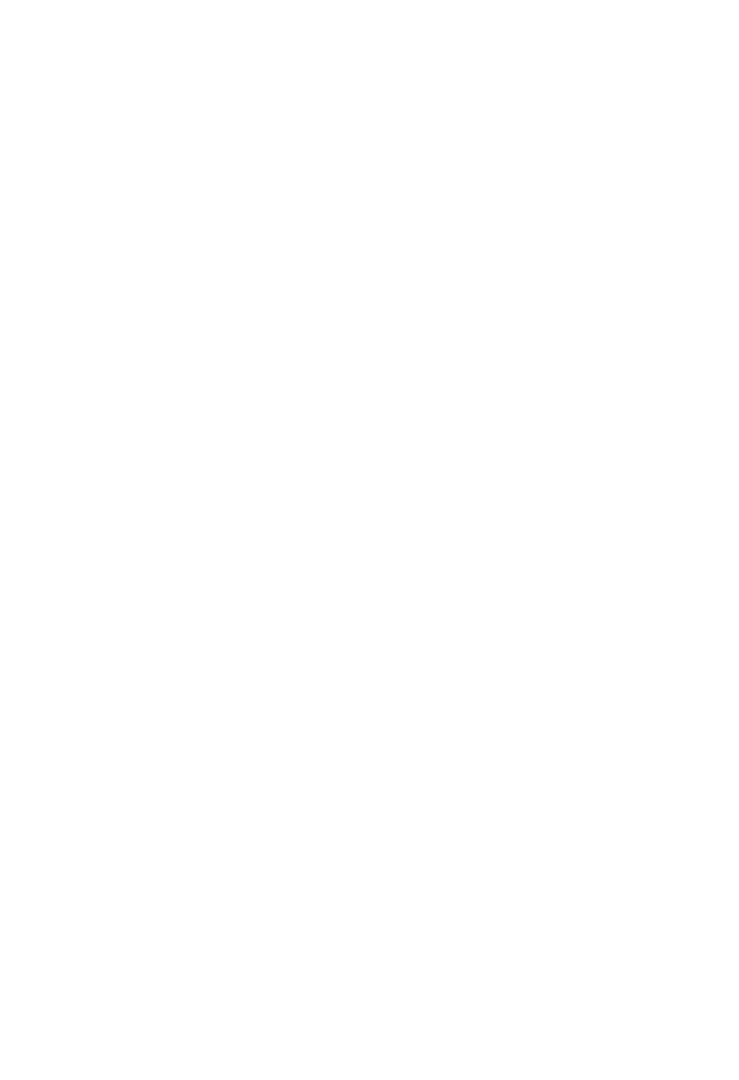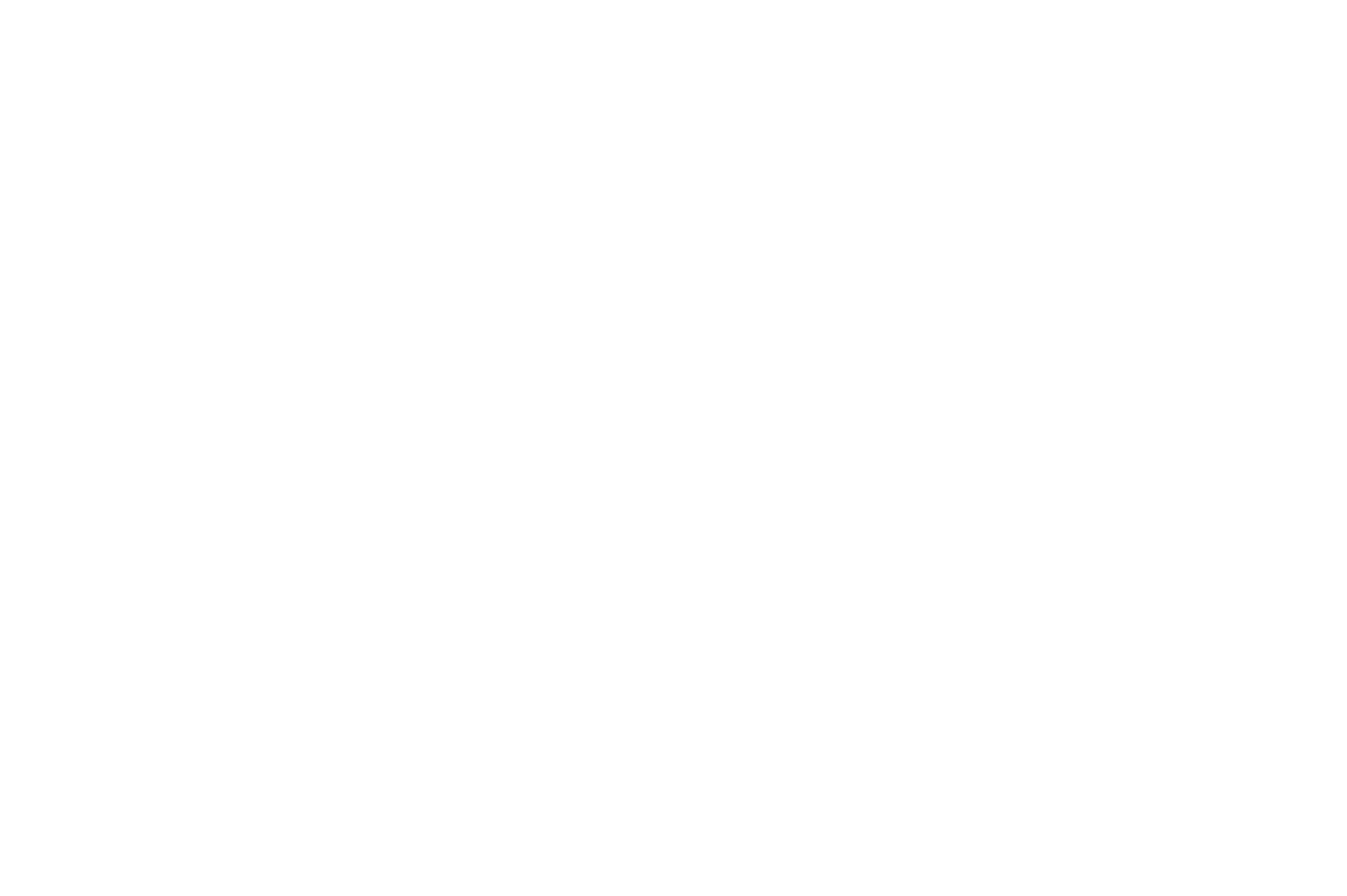Intendant Enrico Lübbe und Chefdramaturg Torsten Buß über die Inszenierung „Kasimir und Karoline“
Horváths Stücke sind durch einen spezifischen Rhythmus gekennzeichnet. Welche Rolle spielen Sprache und Musik dabei?
Torsten Buß: Die Sprache ist in unseren Augen das Entscheidende an Horváths Stücken. Horváth hat eine sehr genaue Sprache für seine Figuren geschrieben, es gibt wenige Autoren, die mittels der Sprechweise ihrer Figuren so viel über sie erzählen wie er. Man erhält einen sehr guten Eindruck davon, wie Menschen sich mittels Sprache darstellen bzw. darstellen wollen.
Diesbezüglich hat sich die Horváth-Rezeption seit der Uraufführung ziemlich geändert. Die Uraufführung hat den Schwerpunkt auf das Rummelplatzstück gesetzt, was Horváth ziemlich gestört hat. Er hat daraufhin eine „Gebrauchsanweisung“ geschrieben, in der er deutlich macht, dass es ihm nicht zentral um den Rummelplatz geht, sondern um die Charaktere, die sich dort treffen, und um die Gesellschaft. Um die Zwischentöne und Abgründe. Die Sprache schien in der Uraufführung nicht so wichtig, und auch in den 1970er und 1980er Jahren war die bestimmende Horváth-Rezeption, gescheiterten Figuren dabei zuzuschauen, wie sie mit Sprache nicht zurechtkommen. Erst eine Arbeit wie etwa Christoph Marthalers Hamburger Inszenierung von „Kasimir und Karoline“ 1996 hat die Figuren mit großer Würde betrachtet.
Was uns in der Arbeit interessiert: Diese Figuren haben modern gesagt einen gewaltigen Stress. Sie haben ein großes Statusproblem. Und wenn es ihnen anders nicht möglich ist, dann wollen sie wenigstens sprachlich ein positives Bild von sich in die Welt setzen. Das ist eine Strategie, und in diesem Sinne haben sie eine enorme Sprachkompetenz. Horváth hat dafür sehr genaue Dialoge geschrieben. Es ist eine der großen Aufgaben bei Horváths Texten, das Nichtgesagte zu inszenieren. Aber das heißt ja auch, dass es unglaublich viel Nichtgesagtes gibt, was durch die Figuren hindurchgeht.
Enrico Lübbe: Aus diesem Grund spielen für uns Musik und Rhythmus in der Inszenierung eine große Rolle. Torsten hat einen Kollegen von Philipp Marguerre am Verrophon in der Oper in Köln gesehen und fand das Instrument und den Klang für unsere Inszenierungsidee passend. Wir sprachen daraufhin mit Philipp, für den es eine besondere Erfahrung ist, so in eine Inszenierung eingebunden zu sein. Das Verrophon produziert einerseits wunderschöne Töne, andererseits können sie schmerzhaft sein, flirrend, wie das Stück. Die Schwierigkeit des Stückes, das Nichtgesagte zu inszenieren, das, was „dazwischen“ stattfindet, ist für den Regisseur und die Schauspieler die meiste Arbeit und lässt sich hier auch auf die Musik übertragen.
Diesbezüglich hat sich die Horváth-Rezeption seit der Uraufführung ziemlich geändert. Die Uraufführung hat den Schwerpunkt auf das Rummelplatzstück gesetzt, was Horváth ziemlich gestört hat. Er hat daraufhin eine „Gebrauchsanweisung“ geschrieben, in der er deutlich macht, dass es ihm nicht zentral um den Rummelplatz geht, sondern um die Charaktere, die sich dort treffen, und um die Gesellschaft. Um die Zwischentöne und Abgründe. Die Sprache schien in der Uraufführung nicht so wichtig, und auch in den 1970er und 1980er Jahren war die bestimmende Horváth-Rezeption, gescheiterten Figuren dabei zuzuschauen, wie sie mit Sprache nicht zurechtkommen. Erst eine Arbeit wie etwa Christoph Marthalers Hamburger Inszenierung von „Kasimir und Karoline“ 1996 hat die Figuren mit großer Würde betrachtet.
Was uns in der Arbeit interessiert: Diese Figuren haben modern gesagt einen gewaltigen Stress. Sie haben ein großes Statusproblem. Und wenn es ihnen anders nicht möglich ist, dann wollen sie wenigstens sprachlich ein positives Bild von sich in die Welt setzen. Das ist eine Strategie, und in diesem Sinne haben sie eine enorme Sprachkompetenz. Horváth hat dafür sehr genaue Dialoge geschrieben. Es ist eine der großen Aufgaben bei Horváths Texten, das Nichtgesagte zu inszenieren. Aber das heißt ja auch, dass es unglaublich viel Nichtgesagtes gibt, was durch die Figuren hindurchgeht.
Enrico Lübbe: Aus diesem Grund spielen für uns Musik und Rhythmus in der Inszenierung eine große Rolle. Torsten hat einen Kollegen von Philipp Marguerre am Verrophon in der Oper in Köln gesehen und fand das Instrument und den Klang für unsere Inszenierungsidee passend. Wir sprachen daraufhin mit Philipp, für den es eine besondere Erfahrung ist, so in eine Inszenierung eingebunden zu sein. Das Verrophon produziert einerseits wunderschöne Töne, andererseits können sie schmerzhaft sein, flirrend, wie das Stück. Die Schwierigkeit des Stückes, das Nichtgesagte zu inszenieren, das, was „dazwischen“ stattfindet, ist für den Regisseur und die Schauspieler die meiste Arbeit und lässt sich hier auch auf die Musik übertragen.
Die neue Spielzeit 2017/18 trägt das Motto „Angst oder Liebe“. Warum wurde das Stück „Kasimir und Karoline“ als Eröffnungspremiere gewählt?
Enrico Lübbe: „Kasimir und Karoline“ ist bereits der fünfte Text von Ödön von Horváth, den ich inszenieren darf; mit Daniela Keckeis, Wenzel Banneyer, Michael Pempelforth, Roman Kanonik und Roman Kaminski habe ich schon gemeinsam Horváth-Erfahrungen gesammelt – und das ist hilfreich, denn „Kasimir und Karoline“ ist eines der undramatischsten Horváth-Stücke überhaupt und daher auch eines der schwierigsten. „Geschichten aus dem Wiener Wald“ oder „Glaube Liebe Hoffnung“ haben ein viel steileres Gefälle, „Kasimir und Karoline“ dagegen nur kleinere Nuancen, das Stück flirrt, die Figuren entwickeln sich auf einem schmaleren Grat. Uns war schnell klar, dass in der Inszenierung eine gewisse Form von Realismus notwendig ist, egal ob hyperreal oder überhöht, man kommt nicht daran vorbei. Das Stück ist nicht auf einer leeren „Bühnensetzung“ wie zum Beispiel unserer „Wienerwald“-Welle am Berliner Ensemble spielbar. Und gleichzeitig lässt es sich schwer in die Gegenwart transportieren, da ein Rummelplatz oder die Kleinmesse in Leipzig etwas anderes sind als das Panoptikum, das Horváth entwirft.
Der Untertitel des Stückes lautet: „Und die Liebe höret nimmer auf“. Da klingt unser diesjähriges Spielzeitmotto „Angst oder Liebe“ durch. Bei Horváth ist das ironisch gemeint, das Stück spielt mit einem Bibelzitat und mit dem Gedanken, dass die Liebe bereits aufhört, wenn einer arbeitslos wird. Und andererseits sind Ängste in dem Stück auch sehr präsent, auf verschiedenen Ebenen.
Torsten Buß: Aufstiegswille und Abstiegsängste sind bestimmende Faktoren für das Verhalten der Figuren in „Kasimir und Karoline“. Sie ergeben sich einem enormen Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, und das Stück zeigt eine ziemlich scharf gespaltene Gesellschaft. Das sind die Punkte, an die man anknüpfen kann und sollte. Das Eindrückliche ist auch, dass Horváth in einer noch relativ jungen Demokratie immer wieder Momente und Figuren zeigt, die einen deutlichen Hang zum Autoritären aufblitzen lassen; da werfen die folgenden Jahre ihren Schatten.
„Kasimir und Karoline“ ist aber auch ein Beleg für die Geschichte Leipzigs als Literaturstadt: Die Uraufführung des Stückes war am 18. November 1932 hier in Leipzig. Und genau zum 85. Jahrestag haben wir den Soziologen Heinz Bude eingeladen, nochmal über unsere Bühneninszenierung hinaus mit einem Vortrag den Bogen vom Damals ins Heute zu spannen.
Der Untertitel des Stückes lautet: „Und die Liebe höret nimmer auf“. Da klingt unser diesjähriges Spielzeitmotto „Angst oder Liebe“ durch. Bei Horváth ist das ironisch gemeint, das Stück spielt mit einem Bibelzitat und mit dem Gedanken, dass die Liebe bereits aufhört, wenn einer arbeitslos wird. Und andererseits sind Ängste in dem Stück auch sehr präsent, auf verschiedenen Ebenen.
Torsten Buß: Aufstiegswille und Abstiegsängste sind bestimmende Faktoren für das Verhalten der Figuren in „Kasimir und Karoline“. Sie ergeben sich einem enormen Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, und das Stück zeigt eine ziemlich scharf gespaltene Gesellschaft. Das sind die Punkte, an die man anknüpfen kann und sollte. Das Eindrückliche ist auch, dass Horváth in einer noch relativ jungen Demokratie immer wieder Momente und Figuren zeigt, die einen deutlichen Hang zum Autoritären aufblitzen lassen; da werfen die folgenden Jahre ihren Schatten.
„Kasimir und Karoline“ ist aber auch ein Beleg für die Geschichte Leipzigs als Literaturstadt: Die Uraufführung des Stückes war am 18. November 1932 hier in Leipzig. Und genau zum 85. Jahrestag haben wir den Soziologen Heinz Bude eingeladen, nochmal über unsere Bühneninszenierung hinaus mit einem Vortrag den Bogen vom Damals ins Heute zu spannen.